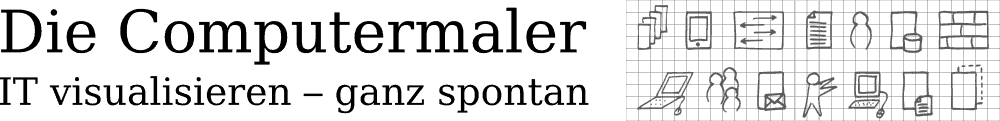Den (Steh‑)Platz vor dem Flipchart oder dem Whiteboard mit den „Brettern, die die Welt bedeuten“1 zu vergleichen, dürfte in den meisten Fällen mehr als vermessen erscheinen. Dennoch: Eben dieser Platz ist Ihre Bühne, meist unmittelbar davor sitzt Ihr mehr oder minder interessiertes Publikum. Dieser Situation ist in den „Computermalern“ ab Seite 94 fast ein ganzes Kapitel gewidmet:
Den (Steh‑)Platz vor dem Flipchart oder dem Whiteboard mit den „Brettern, die die Welt bedeuten“1 zu vergleichen, dürfte in den meisten Fällen mehr als vermessen erscheinen. Dennoch: Eben dieser Platz ist Ihre Bühne, meist unmittelbar davor sitzt Ihr mehr oder minder interessiertes Publikum. Dieser Situation ist in den „Computermalern“ ab Seite 94 fast ein ganzes Kapitel gewidmet:
6.2 Bühne und Publikum
Die Bühne einer Visualisierung ist fast immer ähnlich strukturiert: Menschen sitzen mehr oder minder erwartungsvoll in einem Besprechungs- oder Vortragsraum; idealerweise ist mindestens ein Flipchart oder Whiteboard vorhanden. Ausgehend von dieser Eröffnung gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche dramaturgische Situationen:
Unabhängig davon, in welcher der beiden Rollen Sie sich befinden, lohnt es sich immer, die Bühne zu prüfen, sobald man den Raum betritt2:
Je früher diese Überprüfung der „Bühne“ stattfindet, desto eher können die Verhältnisse noch zu Ihrem Vorteil geändert werden – und das idealerweise unbeobachtet vom künftigen Publikum.
6.3 Dramaturgie
Die Verbindung Ihres Textes (der „Tonspur“) mit Ihrer Visualisierung ergibt die Dramaturgie ihres Theaterstücks. Anders als beim nachträglichen Vertonen eines Films gilt es jedoch nicht, „lippensynchron“ zu sprechen (die Sprache mit dem Bild zu synchronisieren), sondern im Gegenteil den Fortgang der Visualisierung an den Inhalt anzupassen.
Der oft gehörte Hinweis, man solle nicht gleichzeitig schreiben oder zeichnen und sprechen, mag für Hörsäle und Klassenzimmer seine Gültigkeit haben, erscheint für übliche Besprechungen jedoch nicht zwingend: Die akustische Situation ist durch die kleinere (hoffentlich im Vergleich zu einem typischen Klassenzimmer diszipliniertere) Teilnehmeranzahl und den in aller Regel kleineren Raum deutlich günstiger.
Eine typische Sequenz, die sich quasi automatisch ergibt, ist, der Reihe nach zwei oder mehrere Komponenten zu erklären (und parallel zu zeichnen) und anschließend deren Beziehung darzustellen – sprachlich und parallel zeichnerisch. Aus einer Aneinanderreihung solcher Sequenzen entsteht die Dramaturgie der meisten Visualisierungen. Die Reihenfolge, in der die Einzelsequenzen kombiniert werden, folgt dem Text oder Inhalt, an den sich die Visualisierung anlehnt. Innerhalb des gesamten Vortrags erhält eine solche Sequenz einen ähnlichen Charakter wie eine einzelne Folie bei einem „klassisch“ vorbereiteten Vortrag. Neben dem Vorteil der Spontaneität gibt es jedoch einen weiteren großen Unterschied: Es wird praktisch immer weniger Flipchart-Blätter geben, als eine vergleichbare Präsentation Folien gehabt hätte – eine Folie ist schneller erstellt (oder kopiert) als ein Flipchart beschrieben. Die einzelnen Punkte entwickeln sich langsamer und tiefer – im Extremfall passt der komplette Vortrag auf eine große Moderationswand, alle bereits besprochenen Inhalte bleiben sichtbar und können z. B. bei Rückfragen erneut einbezogen werden.
6.4 Alles hat Bedeutung
Zuschauer eines „modernen“ Theaterstücks teilen sich typischerweise in zwei Gruppen: Die einen beschließen bereits lange vor der obligatorischen Pause, das Stück sei ihnen zu abstrakt und sie verstünden es nicht; die anderen sind hoch interessiert und machen sich begeistert daran, jedes Detail der Inszenierung einer umfangreichen Interpretation zu unterziehen – einschließlich des zufälligen Stolperns des einen Schauspielers im dritten Akt. Auch hier gilt: „Es ist unvermeidlich, dass auch unabsichtliches Verhalten als Zeichen genommen und interpretiert wird.“3 (vgl. S. 50).
Ein Theaterregisseur mag die wilden Interpretationen seiner Arbeit durch das Publikum durchaus aktiv provozieren und vom überraschenden Ergebnis womöglich fasziniert sein. Visualisierungen, wie sie Gegenstand dieses Buchs sind, sind jedoch keine kontroversen Kunstwerke – Sie sollten die Deutungshoheit über Ihre Visualisierung so weit wie möglich behalten: Seien Sie sich darüber bewusst, dass alles – jedes Piktogramm, jede Farbwahl, jeder Pfeil und natürlich Ihre „Inszenierung“ selbst sowie die „Tonspur“ – mit Bedeutung belegt wird. Zeichnen Sie nichts, was keine Bedeutung hat, Ihre Zuschauer würden es trotzdem deuten – in aller Regel nicht so, wie Sie es möchten. Wechseln Sie z. B. ohne Grund die Farbe, werden Ihre Zuschauer einen Grund dafür suchen – und notfalls „an den Haaren herbeiziehen“. Eigentlich Gleiches wird auf einmal zu Unterschiedlichem, nur, weil Sie es in unterschiedlichen Farben gezeichnet haben – z. B., weil der Stift leer war. Auf der „Tonspur“ oder gar im Text des Fotoprotokolls ist diese Fehlinterpretation kaum zu kompensieren.
Vermeiden Sie Fehl- und Überinterpretationen: Was und wie Sie zeichnen, sollte auch wirklich etwas (idealerweise klar Erkennbares) bedeuten.
Alle im Text und in den Fußnoten erwähnten Literaturhinweise sind übrigens unter „Literatur und Links im Buch“ komfortabel verlinkt.
Footnotes:
- ↑ Friedrich von Schiller, An die Freunde (1802). Vgl. <https://gutenberg.spiegel.de/buch/gedichte-9097/53>
- ↑ Typischerweise wird stattdessen zuerst die Kaffee‑, Wasser- und Keksversorgung geprüft. Wasser ist wichtig, wenn man vorhat, viel zu sprechen. Flipchart und Whiteboard sind wichtiger.
- ↑ Vgl. Linke, Angelika; Nussbaumer, Markus; Portmann, Paul R.: Studienbuch Linguistik. 3., unveränd. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag GmbH. & Co. KG 1996. S. 29.