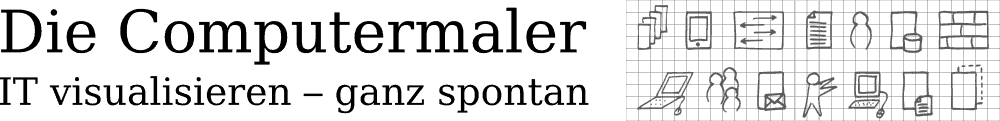„Das hatten wir noch gar nicht!“ ist der wohl meistgehörte Satz, hilft man Schülern bei den Hausaufgaben. Die vermeintlich neue Herausforderung wird so in meist vorwurfsvollem Ton zur Zumutung erklärt. Die dahinterstehende, oft recht gefestigte Haltung „Ich muss genau den Fall schon einmal im Unterricht gehabt haben, sonst ist die Aufgabe ‚unfair‘ “, mag unter Bequemlichkeitsaspekten verständlich sein, sie zeugt aber definitiv nicht davon, dass die Schule an dieser Stelle besonders gut auf das Leben vorbereitet1. Der Verdacht liegt nahe: Die dem Menschen m. E. eigentlich inhärente Freude am Lösen neuer Probleme – am „harte Nüsse knacken“ – ist oft (vermutlich schon über Generationen) mindestens teilweise quasi „weg-sozialisiert“.
Im „richtigen Leben“ begegnen einem nun einmal kontinuierlich völlig neuen Herausforderungen – Projekte gar sind per definitionem einmalig2 und i. d. R. etwas jeweils Neues – und wollen ohne großes Murren gemeistert werden. Egal, ob als Grundschüler oder als Erwachsener mit womöglich Jahrzehnten Berufserfahrung: Das Neue auf Basis der bisherigen Erfahrungen zu meistern, ist meist die Aufgabe – allein schon, weil die Welt um einen herum sich ändert und Neues das Alte ersetzt. Dennoch erlebe ich beispielsweise im technischen Support oft, dass Incidents einfach nur eskaliert werden, weil man sich mit dem Thema/Problem nicht auskenne – eine erwachsene Variante von „Das hatten wir noch gar nicht!“. Die Reaktion darauf (und das ist in der Arbeitswelt oft nicht anders als in der Schule) ist meist, die Problemlösung in starre Schemata zu pressen, und Wissen so vermeintlich zu sozialisieren – Unbekanntes aber wird so nicht handhabbarer!
Auf einem Schiff sind 26 Schafe und 10 Ziegen. Wie alt ist der Kapitän?
Und so verwundert es kaum, dass das, was man in der schulischen Pädagogik das „Kapitänssyndrom“ nennt, in der Arbeitswelt der Erwachsenen in Form von Maslows Hammer (vor allem in Bezug auf Methoden, vgl. hier und hier) wieder auftaucht. Sozialisationsbedingt wird oft nach fertigen, exakt passenden Schemata gesucht, anstelle zu abstrahieren und so vorhandene Denkstrukturen durch sinnvolle Rekombination anwendbar zu machen (und nebenbei neue zu schaffen). Häufig wird meiner Erfahrung nach lieber Unpassendes passend gemacht – oder es werden METHODEN quasi zur Religion, also zum immer Passenden – erklärt. Die Idee, man müsse sich einfach nur an die „richtige“ Formel erinnern und dann rechnen, ist uns quasi anerzogen.
„Ferner, abstrakt lernt man denken
durch abstraktes Denken.“
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)3
Nun möchte ich an dieser Stelle nicht die Vorteile vorgefertigter Methoden leugnen. Eine Textaufgabe zu lösen, ist viel einfacher, wenn ich dazu in der Lage bin, Gleichungssysteme zu lösen – aber es geht übrigens auch ohne, durch „bloßes Denken“! Setze ich jedoch einfach nur die Anzahl der Schafe und Ziegen in eine irgendwann bereits erfolgreich verwendete Gleichung ein, helfen mir meine Algebra-Kenntnisse nicht weiter. Methoden können helfen, auch Unbekanntes zu meistern – aber mit Gleichungen zu hantieren, ohne sie verstanden zu haben, führt i. d. R. nicht zum Ziel.
Methoden wollen erlernt und zielgerichtet angewandt sein. Habe ich keine passende Methode in meinem Werkzeugkasten, so muss ich eine erlernen; gibt es keine, so muss ich eine schaffen.
Neue Probleme kommen so oder so. Sie begeistert zu begrüßen – und vor allem kein Umfeld zu schaffen, das durch Schematisierung das Gegenteil begünstig – ist die m. E. pragmatisch betrachtet einzig sinnvolle Haltung. Und wir sollten vermeiden, das Alter des Kapitäns zu berechnen.
Fußnoten:
- ↑ Und das Elternhaus übrigens auch nicht, oft erscheint mir diese Haltung übernommen zu werden: Beschwerden über Aufgaben, die „noch gar nicht ‚dran“ gewesen seien, höre ich häufig auch von Eltern.
- ↑ DIN 69901.
- ↑ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s [sic!] Werke: Briefe von und an Hegel. Berlin: Duncker und Humblot 1835. S. 345. Bei Google Books unter <https://books.google.de/books?id=1PETAAAAQAAJ&hl=de&pg=PA345#v=onepage&q&f=false>.