Fast immer, wenn ich mit Menschen über Online-Meetings rede und die Sprache auf mein ja schon ein wenig in die Jahre gekommenes Buch zu diesem Thema kommt, fällt mir auf: Seit Beginn des pandemiebedingten „Homeoffice-Booms“ hat sich einiges, was ich damals für richtig und wichtig hielt, durch eigene und fremde Erfahrung, eine Weiterentwicklung der sozialen Normen und nicht zuletzt auch durch technische Innovationen stark verändert. So würde ich beispielsweise nicht mehr grundsätzlich in jeder Meeting-Situation dazu raten, das Mikrofon zu muten, wenn man selber nicht spricht – eine Regel, die ich früher geradezu dogmatisch vertreten habe. Zwischenzeitliche Innovationen (u. a. verbesserte Mikrofone, bessere Filter-Mechanismen und bessere Echo-Unterdrückung) und gesammelte Erfahrung (in kleineren Gruppen ist der Diskurs mit „offenen“ Mikrofonen lebhafter) haben mich eines Besseren belehrt1 und ich beurteile die Frage „Mikrofon an oder aus?“ inzwischen deutlich situativer.
Ähnlich verhält es sich auch mit der Kamera. War ich anfänglich ein glühender Verfechter der These, die Kamera schaffe sozial-kommunikative Nähe und verbessere die Kommunikation, würde ich das inzwischen doch deutlich situativ-differenzierter beurteilen und durchaus auch Nachteile in der visuellen Komponente von Videokonferenzen erkennen – aufgrund eigener Erfahrung und Beobachtung, aber nicht zuletzt auch aufgrund zwischenzeitlicher arbeits- und kommunikationspsychologischer Untersuchungen.
Die angeschaltete Kamera trägt nach verschiedenen Studien maßgeblich zur sogenannten „Zoom-Fatigue“ bei.2 Bei genauerer Betrachtung erscheinen mir dieses Forschungsergebnis und seine Interpretation sehr naheliegend, denn das Kamerabild im Online-Meeting unterscheidet sich qualitativ und quantitativ von der visuellen Wahrnehmung in Präsenz-Meetings:
- Man sieht sich selbst mehr oder minder kontinuierlich, ist gegenüber einer Besprechungssituation in Präsenz extrem vermehrt geradezu gezwungen oder zumindest daran erinnert, das rein optische Außenbild einer Prüfung bzw. Optimierung zu unterziehen. Inzwischen bieten viele Software-Produkte zwar die Möglichkeit, das eigene Videobild zu deaktivieren – aber wer tut das schon, kann man doch so überprüfen, „was für ein Bild man gerade abgibt“? Den Teilnehmern wird also kontinuierlich der Spiegel vorgehalten. Man stelle sich einmal einen physischen Meeting-Raum vor, dessen Wände komplett verspiegelt wären – wer fände das nicht irritierend?
- Im Gegensatz zu einem Präsenz-Meeting kann man nicht erkennen, wer einen gerade anschaut oder wer nicht. Sitzend am Besprechungstisch nimmt man dies meist sehr genau bewusst oder unbewusst wahr und passt sein Verhalten daran an, im Falle einer Videokonferenz hingegen muss man jederzeit davon ausgehen, angeschaut und beobachtet zu werden – dass dies eine Mehrbelastung ist, erscheint mir naheliegend.
- Insgesamt steigert das Videobild den Aufwand, den man neben der rein inhaltlichen Kommunikation für die Selbstrepräsentation zu betreiben geneigt oder besser genötigt ist. Ob diesem Aufwand ein Beitrag zur inhaltlichen Arbeit entgegensteht, erscheint mir sehr zweifelhaft; womöglich steigert das eigene wie auch das Videobild der anderen Teilnehmer lediglich die [extraneous] cognitive load.
- Weniger erforscht, aber ebenso naheliegend in Bezug auf das Erschöpfungspotenzial erscheint mir zudem noch die Mobilitätseinschränkung, die mit dem eigenen Kamerabild einhergeht: Telefonierend bleibe ich selten am Schreibtisch sitzen, laufe meist auf und ab – willkommene und gesundheitlich zweifelsohne sinnvolle Bewegung im Arbeitsalltag eines Büro-Menschen, aber potenziell auch kognitiv wertvoll und kreativitätssteigernd3. Ein Meeting ohne Kamera vom mobilen Endgerät durchzuführen und sich dabei zu bewegen (womöglich gar in der Natur), kann je nach Thema durchaus sinnvoll sein. Sich womöglich ganztätig kontinuierlich an den Aufnahmebereich der Kamera zu binden, erscheint mir schon aus gesundheitlichen Gründen wenig sinnvoll.
So theoretisch-konstruiert die hier in den Fußnoten erwähnten Studien auch erscheinen: Jeder der gerade erwähnten Aspekte hat inzwischen Eingang gefunden in die Handreichung „Zoom-Fatigue“ der DGUV4, ist also keinesfalls mehr reine Theorie aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm, sondern Gegenstand handfest-praktischer Fragen des Arbeitsschutzes.
Verfolgt man also analog zur Frage „Mikrofon an oder aus?“ einen situativen Ansatz, stellt sich m. E. vor allem eine Frage: Bringt das Kamerabild in dieser Situation für das Erreichen des Meeting-Ziels sozial-kommunikativ mehr, als die dadurch entstehende Belastung kostet? Meiner persönlichen Erfahrung nach ist die Antwort auf diese Frage oftmals „ja“, sofern es sich um ein kurzes, kompaktes Meeting mit einer stark ausgeprägten psychosozialen Komponente handelt – z. B. ein kurzes tägliches Team-Jour-Fixe5 – und gegen „Wände“ aus ausgeschalteten Kameras zu reden, ist ohne Zweifel in vielen Situationen auch eher unangenehm. Im Falle eines ganztägigen Arbeitsmeetings oder einer ganztägigen Fortbildung wird die Antwort – vielleicht bis auf wenige spezifische Phasen, beispielsweise Begrüßung und Abschied – jedoch m. E. eher „nein“ lauten. Ganz sicher bin ich mir in einem Punkt: Eine dogmatische „Die Kamera ist immer an!“-Regel ist nicht sinnvoll. Das jeweilige soziale System nicht an der emergenten Entwicklung eigener Normen zu hindern, erscheint mir – vor allem im Falle relativ stabiler Gruppen bzw. Teams – am sinnvollsten.
Footnotes:
- ↑ Wirklich immer ein Headset zu verwenden ist allerdings für mich nach wie vor ein ceterum censeo.
- ↑ Vgl. bspw. <https://hbr.org/2021/10/research-cameras-on-or-off> (04.07.2025) bzw. Shockley, K. M., Gabriel, A. S., Robertson, D., Rosen, C. C., Chawla, N., Ganster, M. L., & Ezerins, M. E. (2021). The fatiguing effects of camera use in virtual meetings: A within-person field experiment. Journal of Applied Psychology, 106(8), 1137 – 1155. sowie <https://news.stanford.edu/stories/2021/02/four-causes-zoom-fatigue-solutions> (04.07.2025) bzw. Fauville, Geraldine and Luo, Mufan and Queiroz, Anna C. M. and Bailenson, Jeremy N. and Hancock, Jeff, Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (February 15, 2021). Verfügbar unter SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3786329> oder <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3786329>.
- ↑ Vgl. <https://news.stanford.edu/stories/2014/04/walking-vs-sitting-042414> (04.07.2025) bzw. Oppezzo, M., & Schwartz, D. L. (2014). Give your ideas some legs: The positive effect of walking on creative thinking. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 40(4), 1142 – 1152.
- ↑ Vgl. <https://publikationen.dguv.de/forschung/iag/praxishilfen/4428/praxishilfe-zoom-fatigue> (04.07.2035).
- ↑ Nebenbei bemerkt: Ist man sich ganz sicher, dass das Kamera-Bild für eine spezifische Interaktion extrem wichtig ist, sollte man sich m. E. auch fragen, ob ein Online-Meeting für diese Interaktion wirklich die richtige Methode ist, ob nicht vielleicht ein Treffen in Präsenz dem Thema angemessener wäre.
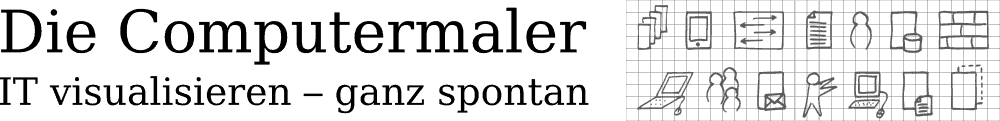
Pingback: #LINKSDERWOCHE | 28/2025: Produktivität, Lean und Agile – Toms Gedankenblog