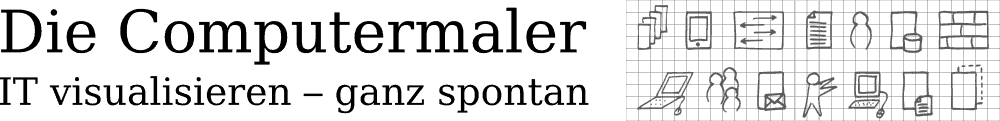Propagiert man das Visualisieren mit „analogen“ Mitteln – lies: ohne PowerPoint oder alternative Präsentationsprogramme (im Folgenden wird „PowerPoint“ als Deonym für alle vergleichbaren Präsentationsprogramme betrachtet) –, gerät man schnell in den Verdacht, ein Gegner eben dieser Programme zu sein, sie mehr oder minder dogmatisch abzulehnen. Dieser Verdacht ist zumindest in Bezug auf meine Person unbegründet – ich arbeite sehr gern mit PowerPoint und bin ein großer Bewunderer von Garr Reynolds und seinen Büchern (siehe http://www.presentationzen.com). Richtig ist aber, dass ich schlechte oder unangemessene Anwendung von Präsentationsprogrammen nur sehr schwer ertragen kann.
PowerPoint für a priori gefährlich zu halten und deswegen abzulehnen, ist vergleichbar damit, einen Hammer abzulehnen, weil es Menschen gibt, die sich damit (womöglich bei dem Versuch, eine Schraube als Nagel zu verwenden) auf den Finger gehauen haben. Richtig ist aber auch, dass es viele Beispiele gibt, in denen eine schlechte oder unangemessene Anwendung von PowerPoint tatsächlich Schaden angerichtet hat – Edward Tuftes berühmtes Essay „The Cognitive Style of PowerPoint“ sei dem geneigten Leser als eher fundierte denn dogmatische Referenz genannt1. Auf der anderen Seite werden Ihnen unzählige Unfallchirurgen bestätigen: Es haben sich schon unzählige Menschen ihren Daumen mittels eines Hammers schwer verletzt.
Ich schrieb eingangs, ich könne unangemessene und schlechte Anwendung von Präsentationsprogramme schlecht ertragen. Um genau diese beiden Punkte geht es nach meiner Erfahrung, wenn es gilt, PowerPoint und andere Präsentationsprogramme sinnvoll einzusetzen: Das Werkzeug muss für die richtigen Dinge in der richtigen Weise genutzt werden. In den Händen eines qualifizierten und erfahrenen „Handwerkers“ wird das Werkzeug PowerPoint so zu einem wertvollen und nicht wegzudenkenden Bestandteil der Werkzeugtasche.
Die richtigen Dinge
Wann nun ist eine Nutzung von PowerPoint unangemessen? Ein schönes (wenn auch überspitztes) Beispiel dafür liefert Peter Norvig in seiner in PowerPoint umgesetzten Version von Abraham Lincolns Gettysburg-Rede von 1863 (http://norvig.com/Gettysburg/). In Norvigs Händen wird eine der größten Reden der amerikanischen Geschichte mit Hilfe von PowerPoints „AutoInhalt-Assistenten“ zu einer Parodie ihrer selbst; die radikale Reduktion des Inhalts auf einzelne „bullet points“ macht es undenkbar, vor dem Hintergrund dieser Präsentation eine inspirierende Rede zu halten. Norvigs Präsentation wird seither regelmäßig als Beispiel für Kritik an PowerPoint aufgeführt – dabei handelt es sich lediglich um eine Kritik an „too many bad presentations“, daran, dass „PowerPoint or other visual aids obscure, rather than enhance the point“2.
Was nun sagt uns Norvigs Beitrag wirklich? Norvigs Experiment hat im Wesentlichen gezeigt, dass eine unglaublich schlechte Präsentation möglich ist und einen herausragenden Vortrag eines begnadeten Redners ruinieren könnte. Steve Jobs und viele andere einflussreiche Redner hingegen haben gezeigt, dass auch mit (und nicht nur trotz) PowerPoint (im Falle von Jobs vermutlich eher Keynote) eine inspirierende Rede haltbar ist – man denke nur an unzählige Beiträge zur TED (Konferenz für „Technology, Entertainment, Design“; http://www.ted.com). Die Tatsache, dass im öffentlichen politischen Leben PowerPoint dennoch praktisch keine Rolle spielt, ist also vermutlich eher einer kulturellen Norm als einer tatsächlich mangelnden Eignung zuzuschreiben. Sich Barack Obama vor dem Hintergrund einer PowerPoint-Präsentation vorzustellen, entspricht einfach nicht hinreichend dem Bild eines idealen Redners im Sinne der Ausführungen von Marcus Tullius Ciceros „De oratore“.
Wann also ist PowerPoint tatsächlich das falsche Werkzeug? Aus meiner Sicht sind hier zwei Fälle zu unterscheiden: die eigentliche Anwendung beim Präsentieren und die Anwendung beim Erschaffen der Inhalte des Vortrags.
Beim Präsentieren halte ich PowerPoint immer dann für ungeeignet, wenn die starre Sequentialität der Folien dem tatsächlichen (Gruppen‑)Prozess nicht angemessen ist. Lebt der Vortrag stark von der „allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden“3 (Heinrich von Kleist) oder von der Interaktion mit dem Auditorium oder handelt es sich gar in Wirklichkeit gar nicht um einen Vortrag, sondern um einen dynamischen Gruppenprozess, kann auch die handwerklich beste Präsentation die Kreativität des Redners oder der Gruppe auf ihrem starren Zeitstrahl von Folien gleichsam aufspießen. Handelt es sich aber um einen „echten“ Vortrag im Sinne einer „vorgefertigten“ Sequenz sprachlicher Zeichen, kann ich keinen Grund erkennen, warum sich dieser nicht durch eine parallele Sequenz visueller Zeichen (meist Ikonen i. S. von Charles S. Peirce) ergänzen oder zumindest unterstützen ließe.
Immer ungeeignet erscheint mir PowerPoint als Werkzeug zum Verfassen von Vorträgen. Die Ikonografie der Präsentation sollte den Inhalten der eigentlichen Rede und ihrer Dialektik folgen – PowerPoint bereits in einer frühen Phase des Verfassens einzusetzen, überbetont den Aspekt der Folien, ihrer Sequenz und des Graphischen und beschränkt das Denken auf die denkbaren Strukturen der Präsentationssoftware. Die enge und stark durch die Benutzeroberfläche beeinflusste Bildsprache beginnt das Denken zu formen4; die „semantische Struktur“ von PowerPoint tritt anstelle der semantischen Struktur der jeweiligen menschlichen Sprache. Tun Sie das Ihrem Hirn nicht an – Ihre Gedanken sind zu wertvoll, um in dieses einschnürende Korsett gezwängt zu werden. Papier und Bleistift, ein Whiteboard oder vielleicht eine Anzahl Haftnotizen (wie von Garr Reynolds empfohlen) lassen Ihren Gedanken die Freiheit, die sie verdient haben.
Warum nun wird PowerPoint so häufig konträr zum gesunden Menschenverstand für völlig ungeeignete Anwendungsfälle genutzt? Bezüglich des Anwendungsfalls – der Dinge, für die es genutzt wird – scheint für PowerPoint das zu gelten, was Abraham Maslow sinngemäß über den Hammer sagte: „Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel“5. Neben der Unkenntnis alternativer Werkzeuge und Methoden spielen sicherlich zwei Formen von Normen eine große Rolle: Sozialnormen (jeder nutzt PowerPoint) und von der Organisation geschaffene explizite Normen (die Vorschrift, PowerPoint zu nutzen – oft verbunden mit der Vorschrift, eine mehr oder minder geeignete Vorlage zu nutzen). Sozialnormen zu verletzen erfordert Mut – hat man dies jedoch erfolgreich getan, ist damit oftmals die Axt an die zuvor so unantastbare Norm angelegt. Ob das Verletzen von Vorschriften praktikabel ist, hängt sicherlich von der Organisation ab – auch hier beginnt jedoch mit der ersten Verletzung Georg Jellineks „normative Kraft des Faktischen“; wiederholtes Verletzen hat das Potential, Fakten zu schaffen. Am schwierigsten ist es meiner Erfahrung nach, eine völlig ungeeignete, aber vorgeschriebene Präsentationsvorlage zu ignorieren oder zu modifizieren.
Zum Glück gibt es für Flipchart und Whiteboard keine Vorlagen.
Die richtige Weise
Norvigs Experiment mit Lincolns Gettysburg-Rede hat uns gezeigt, dass unglaublich schlechte Präsentationen möglich sind. Leider zeigt Norvig damit etwas Selbstverständliches – unglaublich schlechte Präsentationen sind möglich. Erstaunlicherweise sind sie nicht nur möglich, sondern scheinen geradezu die Regel zu sein.
Warum ist das so?
Die Nutzung von PowerPoint (wie auch die aller anderen üblichen Bürosoftware) wird heutzutage als eine selbstverständliche Kulturtechnik ähnlich des Lesens und Schreibens betrachtet. Kaum ein Grundschullehrer unterrichtet Lesen und Schreiben in der festen Intention, etwa zwei Dutzend große Schriftsteller auszubilden – die Aufgabe des Lehrers ist vor allem, die Kulturtechnik als solches zu lehren und das ist auch hinreichend: Die Technik des Lesens und des Schreibens wird ein jeder auf jeden Fall zeitlebens gebrauchen können – weitgehend unabhängig beispielsweise von der späteren Berufswahl. PowerPoint und andere Bürosoftware wird – so denn überhaupt eine Schulung der Anwender zu einer solchen „Selbstverständlichkeit“ stattfindet – ebenso unterrichtet: als eine universelle Kulturtechnik, deren Beherrschung allein schon ein erstrebenswertes Ziel ist (man betrachte z. B. das Curriculum des „Europäischen Computerführerscheins“6). Das halte ich für einen Irrglauben: PowerPoint ist ein spezifisches Werkzeug, keine universelle Kulturtechnik. Als Letzteres werden IT-Kenntnisse wohl nur betrachtet, weil Menschen ohne Computerkenntnisse heutzutage ein Gefühl von Ohnmacht entwickeln, das sie mit der Ohnmacht eines Analphabeten für vergleichbar halten.
Niemand würde einem Lehrling ein Werkzeug erklären, ohne umfangreiche Anmerkungen zur sinnvollen und weniger sinnvollen Anwendung zu machen. Ebenso würde niemand von einem Menschen erwarten, ohne umfangreiche Einweisung eine Drehbank zu bedienen. PowerPoint-Kenntnisse hingegen werden vorausgesetzt – und IT-Kenntnisse gelehrt wie in einer Alphabetisierungskampagne; der „Alphabetisierte“ wird schon etwas mit den Kenntnissen anfangen können. Dazu kommt, dass viele Lehrende als „Digital Immigrants (Marc Prensky, „Digital Natives, Digital Immigrants“7) selbst mühsam „IT-alphabetisiert“ wurden und deswegen die eigentliche Werkzeugbeherrschung (die sie mühsam erlernen mussten) gegenüber dem Inhalt überbewerten – eine umfangreich animierte Präsentation eines „Digital Natives“ findet also möglicherweise eher Beifall eines „Immigrants“ als eine gut strukturierte; erlernt wird die „Anreicherung“ der Präsentation mit (zu vielen) Farben, Schriftarten und Animationen, nicht aber das Strukturieren des Vortrags.
Nebenbei bemerkt: Vor dem Hintergrund von Prenskys Begrifflichkeit des „Digital Natives“ erstaunlich finde ich, dass dieselben „Natives“, denen Prensky bezüglich ihrer Rezeption unterstellt, sie wäre eher parallel als sequentiell, sie hätten geradezu „hypertext minds“ („Do They Really Think Differently?“8), in der Produktion bereit sind, ihren Gedankenfluss in streng sequentiell angeordnete Folien förmlich einzusperren. Der Inhalt der womöglich tatsächlich über die Beschränkung des Sequentiellen hinaus holistischeren Gedankengänge wird nur zu oft bereitwillig der schreiend bunten, übermäßig animierten Form geopfert. Folgte die Produktion der Rezeption, wären nicht-sequentielle Präsentationstechniken wie zum Beispiel bei Prezi (http://prezi.com) der Standard in heutigen Klassenzimmern.
Zurück zum Thema: Ein wesentlicher Grund für schlechte Präsentationen ist somit meines Erachtens mangelnde Ausbildung – entweder sie findet gar nicht oder nur autodidaktisch statt oder die maximale Nutzung des Programmes, nicht der maximale Nutzen einer Präsentation steht im Vordergrund. Von gutem (lies: wirksamem) Kommunikationsdesign im funktionalistischen Sinne dürfte praktisch nie die Rede sein.
Es gilt also, diese Defizite – seien sie von institutionalisierter Ausbildung oder autodidaktischer „Einarbeitung“ hinterlassen – selbst zu kompensieren. Glücklicherweise gibt es mehr Veröffentlichungen, die sich mit guten Präsentationen beschäftigen als solche, die Kritik an PowerPoint üben – ich kann mir also längere Ausführungen dazu sparen und auf die einschlägige Literatur verweisen:
- Wirklich hilfreich finde ich persönlich die Bücher von Garr Reynolds (http://www.presentationzen.com); Garr ist sehr konkret und anwendungsnah am Thema „Präsentation“).
- Neben der spezifischen Frage, wie eine den Vortrag unterstützende Präsentation gestaltet sein sollte, stellt sich immer auch die Frage der richtigen Darstellung von Informationen. Edward Tufte (http://www.edwardtufte.com) hat – neben seiner Kritik an PowerPoint – hier Bahnbrechendes geleistet, auch seine Werke sind in höchstem Maße empfehlenswert.
- Jedem, der sich mit einer wissenschaftlich fundierten kulturhistorischen Betrachtung des Themas beschäftigen möchte, sei zudem der folgende von Wolfgang Coy und Claus Pias herausgegebene Sammelband wärmstens ans Herz gelegt: Coy, Wolfgang (Hrsg.); Pias, Claus (Hrsg.): Powerpoint: Macht und Einfluss eines Präsentationsprogramms, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH 2009.
Slideuments
Ein Punkt, auf den ich dennoch – auch in der Gefahr, bereits von anderen Geschriebenes zu wiederholen – eingehen möchte, ist die Thematik der „Slideuments“9. Das Kunstwort „Slideument“ ist ein wohl auf Garr Reynolds zurückgehender Neologismus, der durch Zusammenziehung der Wörter „Slide“ (Folie einer Präsentation) und Document ([Text-]Dokument) geschaffen wurde10. Slideuments sind Ihnen allen sicherlich schon begegnet: eine „Kreuzung“ aus Folie und Textdokument, kurz: Folien, deren Textmenge eher wirkt, als habe der Ersteller (in diesem Fall aufgrund der Textmenge eher: Autor) eher einen Text verfassen als seinen Vortrag durch eine Präsentation unterstützen wollen.
Für die Entstehung von Slideuments gibt es meiner Meinung nach zwei Hauptursachen:
- Das Skript wider Willen: Viele Vortragende verstehen ihre Folien vor allem als „Handouts“ – Ausdrucke oder Dateien, die dem Publikum nach dem Vortrag zur Verfügung gestellt werden. Damit erhalten die Folien automatisch den Charakter eines „Skripts“; der Ersteller versucht, Folien zu erzeugen, die auch ohne die „Tonspur“ des Vortrags autark die Inhalte des Vortrags wiedergeben. Dies ist eine Zweckentfremdung, die dem Ziel, den Vortrag zu unterstützen, praktisch immer zuwiderläuft. Falls Sie ein in sich schlüssiges Skript benötigen, sollten Sie eines schreiben – exportieren Sie zum Beispiel Ihre Folien in eine Textverarbeitung und kommentieren Sie sie. Auf diese Weise vermeiden Sie es, Ihre sämtlichen wertvollen Gedankengänge mit brutaler Gewalt in einige wenige Stichpunkte pressen zu müssen. Nicht nur, dass sie sich im Skript guten Gewissens in ganzen deutschen Sätzen ausdrücken können, auch die Folien können wieder zu dem werden, was sie sein sollten: eine gezielte Unterstützung Ihres verbalen Vortrags.
- Die Rettungsinsel des Referenten: Der zweite häufige Grund für die Entstehung von Slideuments ist in der Unsicherheit des Referenten zu suchen: Die Angst, den Text zu vergessen oder „einen Hänger zu haben“, führt dazu, dass die Folien quasi zum Redeskript werden. Alles, was der Referent zu vergessen befürchtet, muss auf Gedeih und Verderb in einen Stichpunkt gepresst werden; jeder Aspekt der Dialektik des Vortrags muss sich verschriftlicht auf den Folien wiederfinden. Die Folien werden zum mühselig zusammengezimmerten Rettungsfloß im aufgewühlten Meer der Worte, an das sich der Referent im Notfall klammern zu können hofft. Auch dies ist eine Zweckentfremdung – und zudem eine sehr egozentrische: Die Folien sind für Ihr Publikum, nicht für Sie. Falls Sie für sich ein Redeskript benötigen, sollten Sie eines schreiben – benutzen Sie die Notiz-Funktion und die Präsentationsansicht von PowerPoint oder – oftmals praktischer – machen Sie sich Notizen auf Kartei- oder (des Formats wegen meiner Meinung nach praktischeren) Moderationskarten. Karten haben den unschlagbaren Vorteil, dass Sie nicht darüber nachdenken müssen, was Sie auf der Bühne mit ihren Händen anfangen sollen.
Das größte Problem an der Wirkung von Slideuments auf das Publikum ist, dass die meisten Menschen nicht gleichzeitig lesen und zuhören können. Sie werden es aus eigenen Erfahrungen im Publikum vieler Vorträge kennen: Sobald die Folie wechselt, lesen Sie die komplette neue Folie; Ihre Konzentration auf das gesprochene Wort sinkt rapide. Nachdem Sie die Folie fertig gelesen haben, beginnen Sie wieder zuzuhören und „kontrollieren“ anhand der Folie, wie weit der Referent schon in seinen Ausführungen fortgeschritten ist. Noch schlimmer wird es, falls man bereits vor dem Vortrag einen vollständigen Ausdruck aller Folien erhält: Die meisten Menschen beginnen sofort, zu blättern und zu lesen und je nachdem, wie sehr sie an den Inhalten des Vortrags interessiert sind, wird die erreichte Position im Handout so womöglich zum Maßstab des noch zu erduldenden Leides.
Fußnoten:
- ↑ Tufte, Edward R.: The Cognitive Style of PowerPoint. Pitching Out Corrupts Within. 2. Aufl. 2006. Cheshire, Connecticut: Graphics Press 2006.
- ↑ http://norvig.com/Gettysburg/making.html.
- ↑ <http://www.kleist.org/index.php/downloads-u-a-werke-im-volltext/category/16-heinrich-von-kleist-aufsaetze#>.
- ↑ Sprache formt nach Benjamin Whorf bzw. der Sapir-Whorf-Hypothese das Denken – warum sollte das nicht auch für eine visuelle Sprache gelten?
- ↑ Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_instrument .
- ↑ http://www.ecdl.de/.
- ↑ http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf.
- ↑ http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf.
- ↑ Vgl. z. B. http://martinfowler.com/bliki/Slideument.html und
http://www.learninggeneralist.com/2010/02/for-heavens-sake-avoid-slideuments.htmlUpdate 19.08.2019: https://web.archive.org/web/20121109231356/http://www.learninggeneralist.com/2010/02/for-heavens-sake-avoid-slideuments.html. - ↑ Es handelt sich also um ein sog. Kofferwort.